
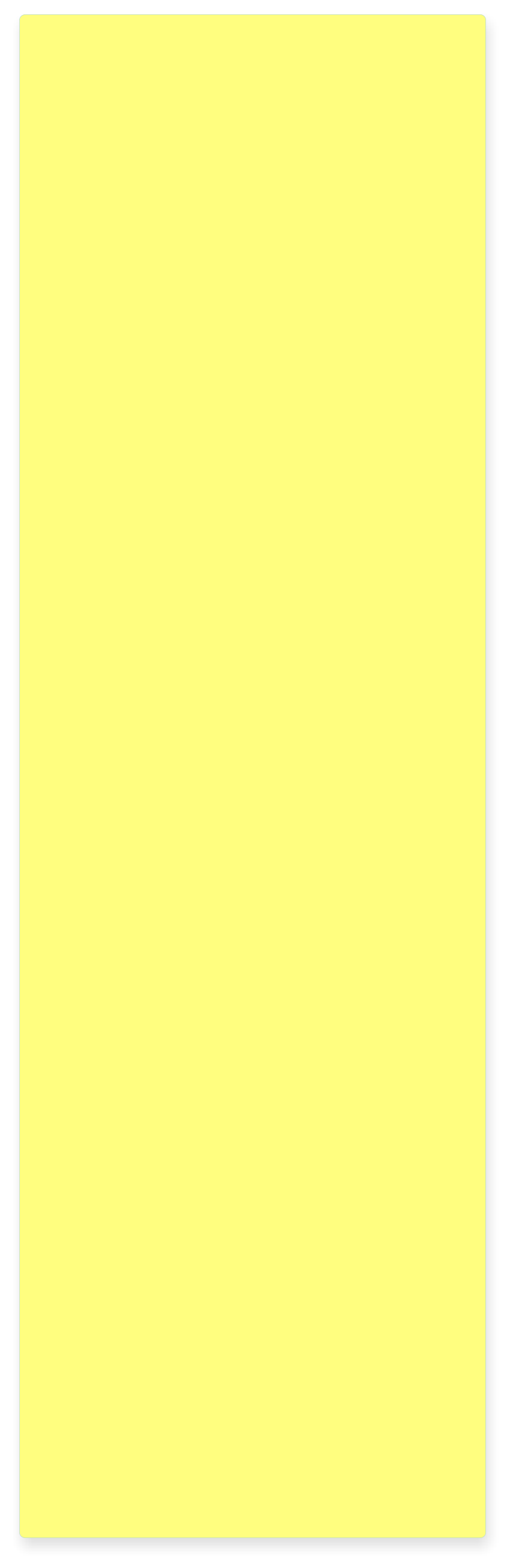 Blick vom Alphubel4206 m zum Monte Rosa
Florian Kluckner, Telefon: +39 - 349.4196 455 P.IVA 02472650031 Kontakt Impressum / Datenschutz Links
Blick vom Alphubel4206 m zum Monte Rosa
Florian Kluckner, Telefon: +39 - 349.4196 455 P.IVA 02472650031 Kontakt Impressum / Datenschutz Links
 Rosengarten, Dolomiten
Sicherheit und das Beziehungsverhältnis zum Berg
Das Thema Sicherheit hat auch beim Bergsteigen eine oberste Priorität. Oft wird diskutiert,
Rosengarten, Dolomiten
Sicherheit und das Beziehungsverhältnis zum Berg
Das Thema Sicherheit hat auch beim Bergsteigen eine oberste Priorität. Oft wird diskutiert, wie die Suche des Bergsteigers nach Abenteuer, Grenzerfahrungen oder „Freiheit“ mit dem
wie die Suche des Bergsteigers nach Abenteuer, Grenzerfahrungen oder „Freiheit“ mit dem Wunsch und Bedürfnis nach größtmöglicher Sicherheit zu vereinbaren sind. Beide, meines
Wunsch und Bedürfnis nach größtmöglicher Sicherheit zu vereinbaren sind. Beide, meines Erachtens konträren Punkte werden in der Alpin Werbung propagiert.
Die Sicherheitsstandards und Normen der Ausrüstung waren wohl noch nie so hoch wie
Erachtens konträren Punkte werden in der Alpin Werbung propagiert.
Die Sicherheitsstandards und Normen der Ausrüstung waren wohl noch nie so hoch wie heute. Geht man heute in ein Sportgeschäft und lässt sich beraten, was man alles zum
heute. Geht man heute in ein Sportgeschäft und lässt sich beraten, was man alles zum Bergsteigen (je nach Bereich) benötigt, wird man schon einmal „ordentlich“ eingekleidet.
Bergsteigen (je nach Bereich) benötigt, wird man schon einmal „ordentlich“ eingekleidet. Wer dann glaubt, mit dieser standardtauglichen, oft teuren Ausrüstung sicher unterwegs zu
Wer dann glaubt, mit dieser standardtauglichen, oft teuren Ausrüstung sicher unterwegs zu sein, kann unter Umständen bittere Enttäuschungen erleben.
sein, kann unter Umständen bittere Enttäuschungen erleben. Es zeigen sich beim Bergsteigen nach meiner Erfahrung sehr unterschiedliche
Es zeigen sich beim Bergsteigen nach meiner Erfahrung sehr unterschiedliche Sicherheitsaspekte. Dies ist einmal der äußere Aspekt der Ausrüstung und deren
Sicherheitsaspekte. Dies ist einmal der äußere Aspekt der Ausrüstung und deren sachgemäßer Gebrauch. Beim Klettern kommt die Ausstattung der Klettertour, ob sie mit
sachgemäßer Gebrauch. Beim Klettern kommt die Ausstattung der Klettertour, ob sie mit Bohrhaken als das sicherste oder mit Normalhaken und natürlichen Sicherungsmitteln
Bohrhaken als das sicherste oder mit Normalhaken und natürlichen Sicherungsmitteln ausgestattet ist, sehr stark zum Tragen.
Ein weiterer, etwas heiklerer Punkt ist die Tourenplanung. Wie steht das Tourenziel, der
ausgestattet ist, sehr stark zum Tragen.
Ein weiterer, etwas heiklerer Punkt ist die Tourenplanung. Wie steht das Tourenziel, der Tourenwunsch mit meinen Fähigkeiten in Verbindung? Entsprechen meine Ziele meinen
Tourenwunsch mit meinen Fähigkeiten in Verbindung? Entsprechen meine Ziele meinen Fähigkeiten? Es ist empfehlenswert, sich von leichteren, kürzeren Zielen langsam auf
Fähigkeiten? Es ist empfehlenswert, sich von leichteren, kürzeren Zielen langsam auf größere Touren vorzubereiten. Man gewinnt so eine Erfahrung für das eigene technische
größere Touren vorzubereiten. Man gewinnt so eine Erfahrung für das eigene technische Können und ein Gefühl für die körperlichen und psychischen Anforderungen am Berg. Wie
Können und ein Gefühl für die körperlichen und psychischen Anforderungen am Berg. Wie stimmen beispielsweise die Angaben einer Tourenbeschreibung, eines Führers, mit der
stimmen beispielsweise die Angaben einer Tourenbeschreibung, eines Führers, mit der eigenen benötigten Zeit überein? Waren die schwierigsten Stellen schon am Limit? Es ist
eigenen benötigten Zeit überein? Waren die schwierigsten Stellen schon am Limit? Es ist eine ehrliche Reflektion nötig, da nur jene eine möglichst reale Einschätzung für die
eine ehrliche Reflektion nötig, da nur jene eine möglichst reale Einschätzung für die nächste Tour gibt.
Neben diesen, mehr „äußeren“ Aspekten gibt es auch einen „inneren“ Aspekt. Er
nächste Tour gibt.
Neben diesen, mehr „äußeren“ Aspekten gibt es auch einen „inneren“ Aspekt. Er betrifft das Beziehungsverhältnis oder die innere Einstellung, mit welcher der
betrifft das Beziehungsverhältnis oder die innere Einstellung, mit welcher der Bergsteiger dem Berg begegnet. Warum plane ich die jeweilige Tour? Ist es die
Bergsteiger dem Berg begegnet. Warum plane ich die jeweilige Tour? Ist es die Faszination für den Berg, seine Eigenheiten, seine spezifische Schönheit? Ist es die
Faszination für den Berg, seine Eigenheiten, seine spezifische Schönheit? Ist es die Suche nach einem ästhetischen Spiel? Dies könnten sein: Die eleganten Bewegungen
Suche nach einem ästhetischen Spiel? Dies könnten sein: Die eleganten Bewegungen beim Klettern, das rhythmische Erleben des Wanderers auf einem harmonisch
beim Klettern, das rhythmische Erleben des Wanderers auf einem harmonisch geschwungenen Weg, oder die Begegnung mit dem weichen, aufnehmenden Element
geschwungenen Weg, oder die Begegnung mit dem weichen, aufnehmenden Element des Schnees im Winter. Die Erlebensweisen sind unterschiedlich und sehr vielfältig.
des Schnees im Winter. Die Erlebensweisen sind unterschiedlich und sehr vielfältig. Oder möchte ich, im Gegensatz hierzu, den Gipfel, eine Felswand, Schwierigkeit oder
Oder möchte ich, im Gegensatz hierzu, den Gipfel, eine Felswand, Schwierigkeit oder Leistung für mich gewinnen? Fühle ich mich dem Berg gegenüber als jemand, der alles
Leistung für mich gewinnen? Fühle ich mich dem Berg gegenüber als jemand, der alles „im Griff“ hat, oder als bescheidener Gast, der auf die guten Bedingungen angewiesen ist?
„im Griff“ hat, oder als bescheidener Gast, der auf die guten Bedingungen angewiesen ist? Heinz Grill schreibt in seinem Buch: „Der Archai und der Weg in die Berge“, dass der
Heinz Grill schreibt in seinem Buch: „Der Archai und der Weg in die Berge“, dass der Bergsteiger, der zu sehr dem Eroberungsdrang unterliegt, immer in einer gewissen Gefahr
Bergsteiger, der zu sehr dem Eroberungsdrang unterliegt, immer in einer gewissen Gefahr ist, ohne dass er es weiß. Er empfiehlt deshalb, bei einer Tour die Möglichkeit eines
ist, ohne dass er es weiß. Er empfiehlt deshalb, bei einer Tour die Möglichkeit eines Rückzuges mit einzukalkulieren und sich offen zu lassen. Dies aber weniger aus
Rückzuges mit einzukalkulieren und sich offen zu lassen. Dies aber weniger aus Ängstlichkeit, sondern aus dem Gefühl des Respektes und Dankbarkeit, die aus der
Ängstlichkeit, sondern aus dem Gefühl des Respektes und Dankbarkeit, die aus der Wirklichkeit des Ausgeliefert-Seins am Berg heraus entsteht. Er schreibt: „Dieses Gefühl
Wirklichkeit des Ausgeliefert-Seins am Berg heraus entsteht. Er schreibt: „Dieses Gefühl der Ehrfurcht, das eine wahrhaftige Tugend und Reife des Menschseins darstellt, ist der
der Ehrfurcht, das eine wahrhaftige Tugend und Reife des Menschseins darstellt, ist der größte Sicherheitsfaktor, den ein Bergsteiger bei seiner Tour haben kann.“
größte Sicherheitsfaktor, den ein Bergsteiger bei seiner Tour haben kann.“ Wie ist diese Aussage zu verstehen? Wie hängt das Gefühl der Ehrfurcht mit der Sicherheit
Wie ist diese Aussage zu verstehen? Wie hängt das Gefühl der Ehrfurcht mit der Sicherheit zusammen? Die folgenden Beispiele können dies verdeutlichen.
zusammen? Die folgenden Beispiele können dies verdeutlichen. Ein Beispiel kann die Erzählung des bekannten, langjährigen Leiters des DAV-
Ein Beispiel kann die Erzählung des bekannten, langjährigen Leiters des DAV- Sicherheitskreises sein, der die Ostwand des Grand Capucin am Mont Blanc besteigen
Sicherheitskreises sein, der die Ostwand des Grand Capucin am Mont Blanc besteigen wollte. Sie beginnt: „....und eigentlich wollten wir ihn im Handumdrehen machen.“ Die
wollte. Sie beginnt: „....und eigentlich wollten wir ihn im Handumdrehen machen.“ Die Geschichte endet aber damit, dass mehrere ungeplante Biwaks in der Wand notwendig
Geschichte endet aber damit, dass mehrere ungeplante Biwaks in der Wand notwendig waren. Eine leichtfertige Einstellung (wir machen ihn im Handumdrehen) endete im Biwak.
waren. Eine leichtfertige Einstellung (wir machen ihn im Handumdrehen) endete im Biwak. Welcher Bergsteiger kennt es nicht, dass das eigene, oder auch aus einer bestimmten
Welcher Bergsteiger kennt es nicht, dass das eigene, oder auch aus einer bestimmten Gruppendynamik heraus entstandene Wollen so groß ist, dass man den Berg mit seinen
Gruppendynamik heraus entstandene Wollen so groß ist, dass man den Berg mit seinen Anforderungen und Bedingungen übersieht. Wie schnell und leicht sind große Pläne in
Anforderungen und Bedingungen übersieht. Wie schnell und leicht sind große Pläne in einer gemütlichen Runde geschmiedet. Die Ideen sind überschwänglich, berauschend und
einer gemütlichen Runde geschmiedet. Die Ideen sind überschwänglich, berauschend und abenteuerlich...
abenteuerlich... Beginnt man dann eine Berg- oder Klettertour mit dem Glauben, problemlos und schnell
Beginnt man dann eine Berg- oder Klettertour mit dem Glauben, problemlos und schnell sein Ziel zu erreichen, so kann es sein, dass man, ins Gespräch mit den Kollegen vertieft,
sein Ziel zu erreichen, so kann es sein, dass man, ins Gespräch mit den Kollegen vertieft, schon die erste Weggabelung übersieht oder sich in der Klettertour versteigt.
schon die erste Weggabelung übersieht oder sich in der Klettertour versteigt. Man kann dann durch unnotwendige, vielleicht gefährliche Umwege, etwas „geläutert“
Man kann dann durch unnotwendige, vielleicht gefährliche Umwege, etwas „geläutert“ wieder auf den richtigen Weg gelangen. Oft meint man in diesen Fällen, dass halt die
wieder auf den richtigen Weg gelangen. Oft meint man in diesen Fällen, dass halt die Tourenplanung nicht ausreichend war und man etwas übersehen hat. Die Reflexion über
Tourenplanung nicht ausreichend war und man etwas übersehen hat. Die Reflexion über die Einstellung oder innere Haltung, die man dem Berg oder dem Unternehmen gegenüber
die Einstellung oder innere Haltung, die man dem Berg oder dem Unternehmen gegenüber hatte, bleibt im Untergründigen.
hatte, bleibt im Untergründigen. Was für ein Bild kann sich im Gegensatz hierzu zeigen? Wie sieht es aus, wenn man
Was für ein Bild kann sich im Gegensatz hierzu zeigen? Wie sieht es aus, wenn man vorsichtiger, mit dem Gefühl des „Nicht-Wissens“ oder des nur Bedingten - Könnens an
vorsichtiger, mit dem Gefühl des „Nicht-Wissens“ oder des nur Bedingten - Könnens an den Berg herangeht? Der Bergsteiger wird schon bei der Tourenplanung hoffen und
den Berg herangeht? Der Bergsteiger wird schon bei der Tourenplanung hoffen und bangen, dass er den Weg gut findet oder die schwierigen Passagen gut meistert. Der
bangen, dass er den Weg gut findet oder die schwierigen Passagen gut meistert. Der Kletterer wird sich die Tourenbeschreibung besonders sorgfältig durchlesen und sich
Kletterer wird sich die Tourenbeschreibung besonders sorgfältig durchlesen und sich Schlüsselstellen einprägen.
Schlüsselstellen einprägen. Er wird bei der Durchführung der Tour schon am Wanderweg genau darauf achten, wo die
Er wird bei der Durchführung der Tour schon am Wanderweg genau darauf achten, wo die richtige Abzweigung kommt, bei einer Klettertour den richtigen Routenverlauf immer
richtige Abzweigung kommt, bei einer Klettertour den richtigen Routenverlauf immer wieder überprüfen und die Möglichkeiten des Abseilens und Abbruchs der Tour
wieder überprüfen und die Möglichkeiten des Abseilens und Abbruchs der Tour miteinkalkulieren.
An diesen Beispielen kann klar werden, dass, wenn der Bergsteiger etwas leichtfertig an
miteinkalkulieren.
An diesen Beispielen kann klar werden, dass, wenn der Bergsteiger etwas leichtfertig an eine Tour herangeht, schnell Missgeschicke, „Verhauer“ oder auch gefährliche Situationen
eine Tour herangeht, schnell Missgeschicke, „Verhauer“ oder auch gefährliche Situationen entstehen können. Die überheblichen Vorstellungen in der Tourenplanung, wie problemlos
entstehen können. Die überheblichen Vorstellungen in der Tourenplanung, wie problemlos ein - oder auch mehrere Berge hintereinander bestiegen werden, lassen sich nicht immer
ein - oder auch mehrere Berge hintereinander bestiegen werden, lassen sich nicht immer mit der Realität verbinden.
mit der Realität verbinden. Gibt man dem Berg im Gegensatz dazu eine reale Autorität und ist sich des eigenen
Gibt man dem Berg im Gegensatz dazu eine reale Autorität und ist sich des eigenen Ausgeliefert-Seins am Berg bewusst, bewegt sich der Bergsteiger vorsichtiger an den
Ausgeliefert-Seins am Berg bewusst, bewegt sich der Bergsteiger vorsichtiger an den Steiganlagen empor. Ich möchte dies als Einordnung in die Dimension des Berges
Steiganlagen empor. Ich möchte dies als Einordnung in die Dimension des Berges bezeichnen. Dies führt dazu, dass die Aufmerksamkeit des Bergsteigers mehr beim Berg und
bezeichnen. Dies führt dazu, dass die Aufmerksamkeit des Bergsteigers mehr beim Berg und seinen hoffentlich guten Bedingungen ist. Dadurch werden diese besser wahrgenommen
seinen hoffentlich guten Bedingungen ist. Dadurch werden diese besser wahrgenommen und vorsichtiger eingeschätzt. Der Bergsteiger rechnet mit schlechten, schwierigen und
und vorsichtiger eingeschätzt. Der Bergsteiger rechnet mit schlechten, schwierigen und mühsamen Bedingungen. Kommen dann die Verhältnisse besser als gedacht, freut man sich
mühsamen Bedingungen. Kommen dann die Verhältnisse besser als gedacht, freut man sich und erlebt den Berg aufnehmend. Hat man im Gegensatz dazu die Bedingungen als zu
und erlebt den Berg aufnehmend. Hat man im Gegensatz dazu die Bedingungen als zu leicht eingestuft, überraschen den Bergsteiger die Schwierigkeiten. Er erlebt den Berg
leicht eingestuft, überraschen den Bergsteiger die Schwierigkeiten. Er erlebt den Berg mühsamer als zuerst gedacht oder erreicht nicht den Gipfel und ist enttäuscht.
mühsamer als zuerst gedacht oder erreicht nicht den Gipfel und ist enttäuscht. Eine konkrete, aufmerksame Wahrnehmung für den Berg schenkt Vertrauen und Nähe.
Eine konkrete, aufmerksame Wahrnehmung für den Berg schenkt Vertrauen und Nähe. Beim Klettern geschieht dies, wenn ich mir die einzelnen Wandabschnitte mit dem
Beim Klettern geschieht dies, wenn ich mir die einzelnen Wandabschnitte mit dem Tourenverlauf genau einpräge. So lerne ich die Wand mit ihren unterschiedlichen
Tourenverlauf genau einpräge. So lerne ich die Wand mit ihren unterschiedlichen Formen wie Pfeiler, Verschneidungen, Kaminen, Platten und Überhängen genau kennen.
Formen wie Pfeiler, Verschneidungen, Kaminen, Platten und Überhängen genau kennen. Diese Formationen geben auch unterschiedliche Empfindungen wie die des Geschützt-
Diese Formationen geben auch unterschiedliche Empfindungen wie die des Geschützt- Seins oder die der Ausgesetztheit. Auch diese können oder sollten schon vorweg erlebt
Seins oder die der Ausgesetztheit. Auch diese können oder sollten schon vorweg erlebt werden. Beim Klettern ist auch die Wandexposition mit einzukalkulieren. Dies nicht nur
werden. Beim Klettern ist auch die Wandexposition mit einzukalkulieren. Dies nicht nur wegen der unterschiedlichen Bekleidung oder Getränke, die mitzuführen sind, sondern
wegen der unterschiedlichen Bekleidung oder Getränke, die mitzuführen sind, sondern auch wegen der unterschiedlichen Stimmungen, welche in den Wänden herrschen. Die N-
auch wegen der unterschiedlichen Stimmungen, welche in den Wänden herrschen. Die N- Wand erscheint oft „strenger“ und „grimmiger“. Die S-Wand freundlich und aufnehmend.
Wand erscheint oft „strenger“ und „grimmiger“. Die S-Wand freundlich und aufnehmend. So vertiefen sich die Vorstellungen über einen Berg und eine Klettertour. Dies ist aber auch
So vertiefen sich die Vorstellungen über einen Berg und eine Klettertour. Dies ist aber auch auf alle anderen Bergtouren zu übertragen.
auf alle anderen Bergtouren zu übertragen. So haben wir in der Tourenplanung drei unterschiedliche Bilder oder Ebenen. Dies sind
So haben wir in der Tourenplanung drei unterschiedliche Bilder oder Ebenen. Dies sind einmal die technischen Informationen mit den Anforderungen, Zeitangaben und
einmal die technischen Informationen mit den Anforderungen, Zeitangaben und Schwierigkeiten. Dann aber auch das Bild des Berges, mit seinen Wänden, Flanken,
Schwierigkeiten. Dann aber auch das Bild des Berges, mit seinen Wänden, Flanken, Pfeilern, seinen steilen und flachen Abschnitten. Als drittes Bild oder Ebene ergeben sich
Pfeilern, seinen steilen und flachen Abschnitten. Als drittes Bild oder Ebene ergeben sich die Empfindungen und Eindrücke, die der Bergsteiger aus der Beschäftigung mit diesen
die Empfindungen und Eindrücke, die der Bergsteiger aus der Beschäftigung mit diesen Bergformen und Expositionen erlebt. Vor allem die letzten beiden Bilder schenken
Bergformen und Expositionen erlebt. Vor allem die letzten beiden Bilder schenken Vertrauen und eine Nähe zum Berg. Dieses Vertrauen und diese Nähe können eine Basis für
Vertrauen und eine Nähe zum Berg. Dieses Vertrauen und diese Nähe können eine Basis für die „innere Sicherheit“ bieten.
die „innere Sicherheit“ bieten. Text zum Drucken und
Herunterladen
Text zum Drucken und
Herunterladen
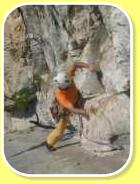 Florian Kluckner in der via
“Il gran diedro” due Laghi
Ein äußerer Aspekt ist
die Ausrüstung und
ihr sachgemäßer
Gebrauch
Florian Kluckner in der via
“Il gran diedro” due Laghi
Ein äußerer Aspekt ist
die Ausrüstung und
ihr sachgemäßer
Gebrauch
 Piz Bernina mit Biancograt
Der innere Aspekt
ergibt sich aus dem
Beziehungsverhältnis
das der Bergsteiger
zum Berg einnimmt
Ist sich der
Bergsteiger der
realen Autorität des
Berges bewusst, so
gewinnt er Sicherheit
Piz Bernina mit Biancograt
Der innere Aspekt
ergibt sich aus dem
Beziehungsverhältnis
das der Bergsteiger
zum Berg einnimmt
Ist sich der
Bergsteiger der
realen Autorität des
Berges bewusst, so
gewinnt er Sicherheit
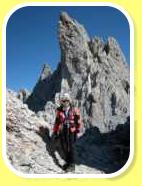 Claudia Bösmüller bei
der kleinen Fermeda,
Dolomiten
Claudia Bösmüller bei
der kleinen Fermeda,
Dolomiten
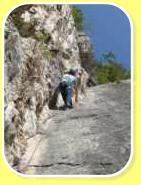 Franz Heiß in der via “Il
gran diedro” due Laghi
Der Mensch fügt sich
in die Umgebung ein
Die Wahrnehmung
für den Berg
schenkt Nähe und
damit Sicherheit
Franz Heiß in der via “Il
gran diedro” due Laghi
Der Mensch fügt sich
in die Umgebung ein
Die Wahrnehmung
für den Berg
schenkt Nähe und
damit Sicherheit
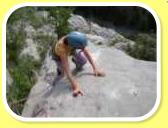 Sandra Schieder in der via
“La bellezza della Venere”,
Piramide Lakschmi
Sandra Schieder in der via
“La bellezza della Venere”,
Piramide Lakschmi









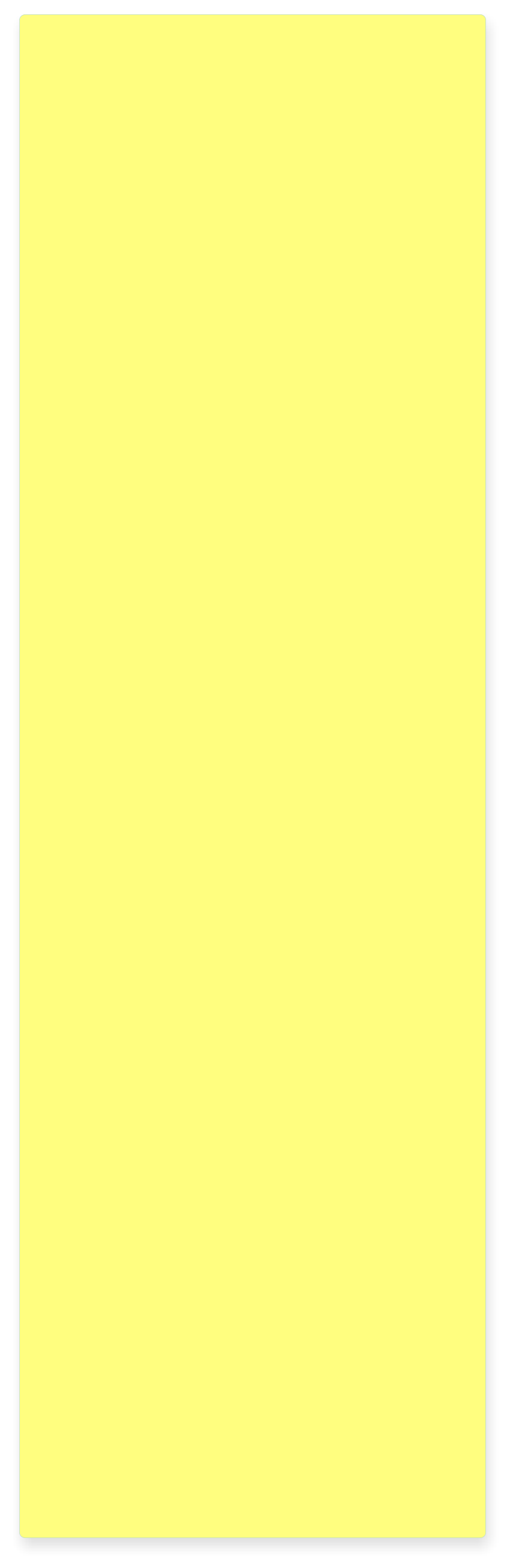 Blick vom Alphubel4206 m zum Monte Rosa
Blick vom Alphubel4206 m zum Monte Rosa
 Florian Kluckner, Telefon: +39 - 349.4196 455 P.IVA 02472650031 Kontakt Impressum / Datenschutz Links
Florian Kluckner, Telefon: +39 - 349.4196 455 P.IVA 02472650031 Kontakt Impressum / Datenschutz Links
 Rosengarten, Dolomiten
Sicherheit und das Beziehungsverhältnis zum Berg
Das Thema Sicherheit hat auch beim Bergsteigen eine oberste Priorität. Oft wird diskutiert,
Rosengarten, Dolomiten
Sicherheit und das Beziehungsverhältnis zum Berg
Das Thema Sicherheit hat auch beim Bergsteigen eine oberste Priorität. Oft wird diskutiert, wie die Suche des Bergsteigers nach Abenteuer, Grenzerfahrungen oder „Freiheit“ mit dem
wie die Suche des Bergsteigers nach Abenteuer, Grenzerfahrungen oder „Freiheit“ mit dem Wunsch und Bedürfnis nach größtmöglicher Sicherheit zu vereinbaren sind. Beide, meines
Wunsch und Bedürfnis nach größtmöglicher Sicherheit zu vereinbaren sind. Beide, meines Erachtens konträren Punkte werden in der Alpin Werbung propagiert.
Die Sicherheitsstandards und Normen der Ausrüstung waren wohl noch nie so hoch wie
Erachtens konträren Punkte werden in der Alpin Werbung propagiert.
Die Sicherheitsstandards und Normen der Ausrüstung waren wohl noch nie so hoch wie heute. Geht man heute in ein Sportgeschäft und lässt sich beraten, was man alles zum
heute. Geht man heute in ein Sportgeschäft und lässt sich beraten, was man alles zum Bergsteigen (je nach Bereich) benötigt, wird man schon einmal „ordentlich“ eingekleidet.
Bergsteigen (je nach Bereich) benötigt, wird man schon einmal „ordentlich“ eingekleidet. Wer dann glaubt, mit dieser standardtauglichen, oft teuren Ausrüstung sicher unterwegs zu
Wer dann glaubt, mit dieser standardtauglichen, oft teuren Ausrüstung sicher unterwegs zu sein, kann unter Umständen bittere Enttäuschungen erleben.
sein, kann unter Umständen bittere Enttäuschungen erleben. Es zeigen sich beim Bergsteigen nach meiner Erfahrung sehr unterschiedliche
Es zeigen sich beim Bergsteigen nach meiner Erfahrung sehr unterschiedliche Sicherheitsaspekte. Dies ist einmal der äußere Aspekt der Ausrüstung und deren
Sicherheitsaspekte. Dies ist einmal der äußere Aspekt der Ausrüstung und deren sachgemäßer Gebrauch. Beim Klettern kommt die Ausstattung der Klettertour, ob sie mit
sachgemäßer Gebrauch. Beim Klettern kommt die Ausstattung der Klettertour, ob sie mit Bohrhaken als das sicherste oder mit Normalhaken und natürlichen Sicherungsmitteln
Bohrhaken als das sicherste oder mit Normalhaken und natürlichen Sicherungsmitteln ausgestattet ist, sehr stark zum Tragen.
Ein weiterer, etwas heiklerer Punkt ist die Tourenplanung. Wie steht das Tourenziel, der
ausgestattet ist, sehr stark zum Tragen.
Ein weiterer, etwas heiklerer Punkt ist die Tourenplanung. Wie steht das Tourenziel, der Tourenwunsch mit meinen Fähigkeiten in Verbindung? Entsprechen meine Ziele meinen
Tourenwunsch mit meinen Fähigkeiten in Verbindung? Entsprechen meine Ziele meinen Fähigkeiten? Es ist empfehlenswert, sich von leichteren, kürzeren Zielen langsam auf
Fähigkeiten? Es ist empfehlenswert, sich von leichteren, kürzeren Zielen langsam auf größere Touren vorzubereiten. Man gewinnt so eine Erfahrung für das eigene technische
größere Touren vorzubereiten. Man gewinnt so eine Erfahrung für das eigene technische Können und ein Gefühl für die körperlichen und psychischen Anforderungen am Berg. Wie
Können und ein Gefühl für die körperlichen und psychischen Anforderungen am Berg. Wie stimmen beispielsweise die Angaben einer Tourenbeschreibung, eines Führers, mit der
stimmen beispielsweise die Angaben einer Tourenbeschreibung, eines Führers, mit der eigenen benötigten Zeit überein? Waren die schwierigsten Stellen schon am Limit? Es ist
eigenen benötigten Zeit überein? Waren die schwierigsten Stellen schon am Limit? Es ist eine ehrliche Reflektion nötig, da nur jene eine möglichst reale Einschätzung für die
eine ehrliche Reflektion nötig, da nur jene eine möglichst reale Einschätzung für die nächste Tour gibt.
Neben diesen, mehr „äußeren“ Aspekten gibt es auch einen „inneren“ Aspekt. Er
nächste Tour gibt.
Neben diesen, mehr „äußeren“ Aspekten gibt es auch einen „inneren“ Aspekt. Er betrifft das Beziehungsverhältnis oder die innere Einstellung, mit welcher der
betrifft das Beziehungsverhältnis oder die innere Einstellung, mit welcher der Bergsteiger dem Berg begegnet. Warum plane ich die jeweilige Tour? Ist es die
Bergsteiger dem Berg begegnet. Warum plane ich die jeweilige Tour? Ist es die Faszination für den Berg, seine Eigenheiten, seine spezifische Schönheit? Ist es die
Faszination für den Berg, seine Eigenheiten, seine spezifische Schönheit? Ist es die Suche nach einem ästhetischen Spiel? Dies könnten sein: Die eleganten Bewegungen
Suche nach einem ästhetischen Spiel? Dies könnten sein: Die eleganten Bewegungen beim Klettern, das rhythmische Erleben des Wanderers auf einem harmonisch
beim Klettern, das rhythmische Erleben des Wanderers auf einem harmonisch geschwungenen Weg, oder die Begegnung mit dem weichen, aufnehmenden Element
geschwungenen Weg, oder die Begegnung mit dem weichen, aufnehmenden Element des Schnees im Winter. Die Erlebensweisen sind unterschiedlich und sehr vielfältig.
des Schnees im Winter. Die Erlebensweisen sind unterschiedlich und sehr vielfältig. Oder möchte ich, im Gegensatz hierzu, den Gipfel, eine Felswand, Schwierigkeit oder
Oder möchte ich, im Gegensatz hierzu, den Gipfel, eine Felswand, Schwierigkeit oder Leistung für mich gewinnen? Fühle ich mich dem Berg gegenüber als jemand, der alles
Leistung für mich gewinnen? Fühle ich mich dem Berg gegenüber als jemand, der alles „im Griff“ hat, oder als bescheidener Gast, der auf die guten Bedingungen angewiesen ist?
„im Griff“ hat, oder als bescheidener Gast, der auf die guten Bedingungen angewiesen ist? Heinz Grill schreibt in seinem Buch: „Der Archai und der Weg in die Berge“, dass der
Heinz Grill schreibt in seinem Buch: „Der Archai und der Weg in die Berge“, dass der Bergsteiger, der zu sehr dem Eroberungsdrang unterliegt, immer in einer gewissen Gefahr
Bergsteiger, der zu sehr dem Eroberungsdrang unterliegt, immer in einer gewissen Gefahr ist, ohne dass er es weiß. Er empfiehlt deshalb, bei einer Tour die Möglichkeit eines
ist, ohne dass er es weiß. Er empfiehlt deshalb, bei einer Tour die Möglichkeit eines Rückzuges mit einzukalkulieren und sich offen zu lassen. Dies aber weniger aus
Rückzuges mit einzukalkulieren und sich offen zu lassen. Dies aber weniger aus Ängstlichkeit, sondern aus dem Gefühl des Respektes und Dankbarkeit, die aus der
Ängstlichkeit, sondern aus dem Gefühl des Respektes und Dankbarkeit, die aus der Wirklichkeit des Ausgeliefert-Seins am Berg heraus entsteht. Er schreibt: „Dieses Gefühl
Wirklichkeit des Ausgeliefert-Seins am Berg heraus entsteht. Er schreibt: „Dieses Gefühl der Ehrfurcht, das eine wahrhaftige Tugend und Reife des Menschseins darstellt, ist der
der Ehrfurcht, das eine wahrhaftige Tugend und Reife des Menschseins darstellt, ist der größte Sicherheitsfaktor, den ein Bergsteiger bei seiner Tour haben kann.“
größte Sicherheitsfaktor, den ein Bergsteiger bei seiner Tour haben kann.“ Wie ist diese Aussage zu verstehen? Wie hängt das Gefühl der Ehrfurcht mit der Sicherheit
Wie ist diese Aussage zu verstehen? Wie hängt das Gefühl der Ehrfurcht mit der Sicherheit zusammen? Die folgenden Beispiele können dies verdeutlichen.
zusammen? Die folgenden Beispiele können dies verdeutlichen. Ein Beispiel kann die Erzählung des bekannten, langjährigen Leiters des DAV-
Ein Beispiel kann die Erzählung des bekannten, langjährigen Leiters des DAV- Sicherheitskreises sein, der die Ostwand des Grand Capucin am Mont Blanc besteigen
Sicherheitskreises sein, der die Ostwand des Grand Capucin am Mont Blanc besteigen wollte. Sie beginnt: „....und eigentlich wollten wir ihn im Handumdrehen machen.“ Die
wollte. Sie beginnt: „....und eigentlich wollten wir ihn im Handumdrehen machen.“ Die Geschichte endet aber damit, dass mehrere ungeplante Biwaks in der Wand notwendig
Geschichte endet aber damit, dass mehrere ungeplante Biwaks in der Wand notwendig waren. Eine leichtfertige Einstellung (wir machen ihn im Handumdrehen) endete im Biwak.
waren. Eine leichtfertige Einstellung (wir machen ihn im Handumdrehen) endete im Biwak. Welcher Bergsteiger kennt es nicht, dass das eigene, oder auch aus einer bestimmten
Welcher Bergsteiger kennt es nicht, dass das eigene, oder auch aus einer bestimmten Gruppendynamik heraus entstandene Wollen so groß ist, dass man den Berg mit seinen
Gruppendynamik heraus entstandene Wollen so groß ist, dass man den Berg mit seinen Anforderungen und Bedingungen übersieht. Wie schnell und leicht sind große Pläne in
Anforderungen und Bedingungen übersieht. Wie schnell und leicht sind große Pläne in einer gemütlichen Runde geschmiedet. Die Ideen sind überschwänglich, berauschend und
einer gemütlichen Runde geschmiedet. Die Ideen sind überschwänglich, berauschend und abenteuerlich...
abenteuerlich... Beginnt man dann eine Berg- oder Klettertour mit dem Glauben, problemlos und schnell
Beginnt man dann eine Berg- oder Klettertour mit dem Glauben, problemlos und schnell sein Ziel zu erreichen, so kann es sein, dass man, ins Gespräch mit den Kollegen vertieft,
sein Ziel zu erreichen, so kann es sein, dass man, ins Gespräch mit den Kollegen vertieft, schon die erste Weggabelung übersieht oder sich in der Klettertour versteigt.
schon die erste Weggabelung übersieht oder sich in der Klettertour versteigt. Man kann dann durch unnotwendige, vielleicht gefährliche Umwege, etwas „geläutert“
Man kann dann durch unnotwendige, vielleicht gefährliche Umwege, etwas „geläutert“ wieder auf den richtigen Weg gelangen. Oft meint man in diesen Fällen, dass halt die
wieder auf den richtigen Weg gelangen. Oft meint man in diesen Fällen, dass halt die Tourenplanung nicht ausreichend war und man etwas übersehen hat. Die Reflexion über
Tourenplanung nicht ausreichend war und man etwas übersehen hat. Die Reflexion über die Einstellung oder innere Haltung, die man dem Berg oder dem Unternehmen gegenüber
die Einstellung oder innere Haltung, die man dem Berg oder dem Unternehmen gegenüber hatte, bleibt im Untergründigen.
hatte, bleibt im Untergründigen. Was für ein Bild kann sich im Gegensatz hierzu zeigen? Wie sieht es aus, wenn man
Was für ein Bild kann sich im Gegensatz hierzu zeigen? Wie sieht es aus, wenn man vorsichtiger, mit dem Gefühl des „Nicht-Wissens“ oder des nur Bedingten - Könnens an
vorsichtiger, mit dem Gefühl des „Nicht-Wissens“ oder des nur Bedingten - Könnens an den Berg herangeht? Der Bergsteiger wird schon bei der Tourenplanung hoffen und
den Berg herangeht? Der Bergsteiger wird schon bei der Tourenplanung hoffen und bangen, dass er den Weg gut findet oder die schwierigen Passagen gut meistert. Der
bangen, dass er den Weg gut findet oder die schwierigen Passagen gut meistert. Der Kletterer wird sich die Tourenbeschreibung besonders sorgfältig durchlesen und sich
Kletterer wird sich die Tourenbeschreibung besonders sorgfältig durchlesen und sich Schlüsselstellen einprägen.
Schlüsselstellen einprägen. Er wird bei der Durchführung der Tour schon am Wanderweg genau darauf achten, wo die
Er wird bei der Durchführung der Tour schon am Wanderweg genau darauf achten, wo die richtige Abzweigung kommt, bei einer Klettertour den richtigen Routenverlauf immer
richtige Abzweigung kommt, bei einer Klettertour den richtigen Routenverlauf immer wieder überprüfen und die Möglichkeiten des Abseilens und Abbruchs der Tour
wieder überprüfen und die Möglichkeiten des Abseilens und Abbruchs der Tour miteinkalkulieren.
An diesen Beispielen kann klar werden, dass, wenn der Bergsteiger etwas leichtfertig an
miteinkalkulieren.
An diesen Beispielen kann klar werden, dass, wenn der Bergsteiger etwas leichtfertig an eine Tour herangeht, schnell Missgeschicke, „Verhauer“ oder auch gefährliche Situationen
eine Tour herangeht, schnell Missgeschicke, „Verhauer“ oder auch gefährliche Situationen entstehen können. Die überheblichen Vorstellungen in der Tourenplanung, wie problemlos
entstehen können. Die überheblichen Vorstellungen in der Tourenplanung, wie problemlos ein - oder auch mehrere Berge hintereinander bestiegen werden, lassen sich nicht immer
ein - oder auch mehrere Berge hintereinander bestiegen werden, lassen sich nicht immer mit der Realität verbinden.
mit der Realität verbinden. Gibt man dem Berg im Gegensatz dazu eine reale Autorität und ist sich des eigenen
Gibt man dem Berg im Gegensatz dazu eine reale Autorität und ist sich des eigenen Ausgeliefert-Seins am Berg bewusst, bewegt sich der Bergsteiger vorsichtiger an den
Ausgeliefert-Seins am Berg bewusst, bewegt sich der Bergsteiger vorsichtiger an den Steiganlagen empor. Ich möchte dies als Einordnung in die Dimension des Berges
Steiganlagen empor. Ich möchte dies als Einordnung in die Dimension des Berges bezeichnen. Dies führt dazu, dass die Aufmerksamkeit des Bergsteigers mehr beim Berg und
bezeichnen. Dies führt dazu, dass die Aufmerksamkeit des Bergsteigers mehr beim Berg und seinen hoffentlich guten Bedingungen ist. Dadurch werden diese besser wahrgenommen
seinen hoffentlich guten Bedingungen ist. Dadurch werden diese besser wahrgenommen und vorsichtiger eingeschätzt. Der Bergsteiger rechnet mit schlechten, schwierigen und
und vorsichtiger eingeschätzt. Der Bergsteiger rechnet mit schlechten, schwierigen und mühsamen Bedingungen. Kommen dann die Verhältnisse besser als gedacht, freut man sich
mühsamen Bedingungen. Kommen dann die Verhältnisse besser als gedacht, freut man sich und erlebt den Berg aufnehmend. Hat man im Gegensatz dazu die Bedingungen als zu
und erlebt den Berg aufnehmend. Hat man im Gegensatz dazu die Bedingungen als zu leicht eingestuft, überraschen den Bergsteiger die Schwierigkeiten. Er erlebt den Berg
leicht eingestuft, überraschen den Bergsteiger die Schwierigkeiten. Er erlebt den Berg mühsamer als zuerst gedacht oder erreicht nicht den Gipfel und ist enttäuscht.
mühsamer als zuerst gedacht oder erreicht nicht den Gipfel und ist enttäuscht. Eine konkrete, aufmerksame Wahrnehmung für den Berg schenkt Vertrauen und Nähe.
Eine konkrete, aufmerksame Wahrnehmung für den Berg schenkt Vertrauen und Nähe. Beim Klettern geschieht dies, wenn ich mir die einzelnen Wandabschnitte mit dem
Beim Klettern geschieht dies, wenn ich mir die einzelnen Wandabschnitte mit dem Tourenverlauf genau einpräge. So lerne ich die Wand mit ihren unterschiedlichen
Tourenverlauf genau einpräge. So lerne ich die Wand mit ihren unterschiedlichen Formen wie Pfeiler, Verschneidungen, Kaminen, Platten und Überhängen genau kennen.
Formen wie Pfeiler, Verschneidungen, Kaminen, Platten und Überhängen genau kennen. Diese Formationen geben auch unterschiedliche Empfindungen wie die des Geschützt-
Diese Formationen geben auch unterschiedliche Empfindungen wie die des Geschützt- Seins oder die der Ausgesetztheit. Auch diese können oder sollten schon vorweg erlebt
Seins oder die der Ausgesetztheit. Auch diese können oder sollten schon vorweg erlebt werden. Beim Klettern ist auch die Wandexposition mit einzukalkulieren. Dies nicht nur
werden. Beim Klettern ist auch die Wandexposition mit einzukalkulieren. Dies nicht nur wegen der unterschiedlichen Bekleidung oder Getränke, die mitzuführen sind, sondern
wegen der unterschiedlichen Bekleidung oder Getränke, die mitzuführen sind, sondern auch wegen der unterschiedlichen Stimmungen, welche in den Wänden herrschen. Die N-
auch wegen der unterschiedlichen Stimmungen, welche in den Wänden herrschen. Die N- Wand erscheint oft „strenger“ und „grimmiger“. Die S-Wand freundlich und aufnehmend.
Wand erscheint oft „strenger“ und „grimmiger“. Die S-Wand freundlich und aufnehmend. So vertiefen sich die Vorstellungen über einen Berg und eine Klettertour. Dies ist aber auch
So vertiefen sich die Vorstellungen über einen Berg und eine Klettertour. Dies ist aber auch auf alle anderen Bergtouren zu übertragen.
auf alle anderen Bergtouren zu übertragen. So haben wir in der Tourenplanung drei unterschiedliche Bilder oder Ebenen. Dies sind
So haben wir in der Tourenplanung drei unterschiedliche Bilder oder Ebenen. Dies sind einmal die technischen Informationen mit den Anforderungen, Zeitangaben und
einmal die technischen Informationen mit den Anforderungen, Zeitangaben und Schwierigkeiten. Dann aber auch das Bild des Berges, mit seinen Wänden, Flanken,
Schwierigkeiten. Dann aber auch das Bild des Berges, mit seinen Wänden, Flanken, Pfeilern, seinen steilen und flachen Abschnitten. Als drittes Bild oder Ebene ergeben sich
Pfeilern, seinen steilen und flachen Abschnitten. Als drittes Bild oder Ebene ergeben sich die Empfindungen und Eindrücke, die der Bergsteiger aus der Beschäftigung mit diesen
die Empfindungen und Eindrücke, die der Bergsteiger aus der Beschäftigung mit diesen Bergformen und Expositionen erlebt. Vor allem die letzten beiden Bilder schenken
Bergformen und Expositionen erlebt. Vor allem die letzten beiden Bilder schenken Vertrauen und eine Nähe zum Berg. Dieses Vertrauen und diese Nähe können eine Basis für
Vertrauen und eine Nähe zum Berg. Dieses Vertrauen und diese Nähe können eine Basis für die „innere Sicherheit“ bieten.
die „innere Sicherheit“ bieten. Text zum Drucken und
Herunterladen
Text zum Drucken und
Herunterladen
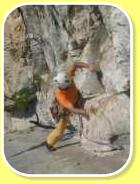 Florian Kluckner in der via
“Il gran diedro” due Laghi
Ein äußerer Aspekt ist
die Ausrüstung und
ihr sachgemäßer
Gebrauch
Florian Kluckner in der via
“Il gran diedro” due Laghi
Ein äußerer Aspekt ist
die Ausrüstung und
ihr sachgemäßer
Gebrauch
 Piz Bernina mit Biancograt
Der innere Aspekt
ergibt sich aus dem
Beziehungsverhältnis
das der Bergsteiger
zum Berg einnimmt
Ist sich der
Bergsteiger der
realen Autorität des
Berges bewusst, so
gewinnt er Sicherheit
Piz Bernina mit Biancograt
Der innere Aspekt
ergibt sich aus dem
Beziehungsverhältnis
das der Bergsteiger
zum Berg einnimmt
Ist sich der
Bergsteiger der
realen Autorität des
Berges bewusst, so
gewinnt er Sicherheit
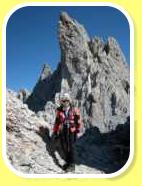 Claudia Bösmüller bei
der kleinen Fermeda,
Dolomiten
Claudia Bösmüller bei
der kleinen Fermeda,
Dolomiten
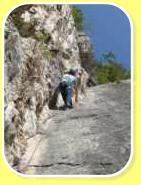 Franz Heiß in der via “Il
gran diedro” due Laghi
Der Mensch fügt sich
in die Umgebung ein
Die Wahrnehmung
für den Berg
schenkt Nähe und
damit Sicherheit
Franz Heiß in der via “Il
gran diedro” due Laghi
Der Mensch fügt sich
in die Umgebung ein
Die Wahrnehmung
für den Berg
schenkt Nähe und
damit Sicherheit
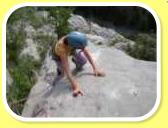 Sandra Schieder in der via
“La bellezza della Venere”,
Piramide Lakschmi
Sandra Schieder in der via
“La bellezza della Venere”,
Piramide Lakschmi








